Kennen Sie das? Sie werden bei einem Termin in Smalltalk verwickelt, Ihnen fällt aber kein Thema ein. Unser Wissens-Doyen Florian hilft. Fortan lässt er nicht nur uns in jeder Mittagspause, sondern auch Sie in unregelmäßigen Abständen an seinem Wissensschatz teilhaben.
Übersicht
- Teil 8: Kanzelkultur
- Teil 7: Trümmerfrauen- ein deutsches Märchen
- Teil 6: Die Zombie-Apokalypse ist da (echt jetzt)
- Teil 5: Darum war die Höhle besser
- Teil 4: Menschenfresser gab es nicht
- Teil 3: Nachtruhe ist etwas Neues
- Teil 2: Ein Komet zieht seinen Schweif nicht hinter sich her
- Teil 1: Darum wurde Münzgeld erfunden
* Wir erweitern diese Sammlung nach und nach.
Kanzelkultur
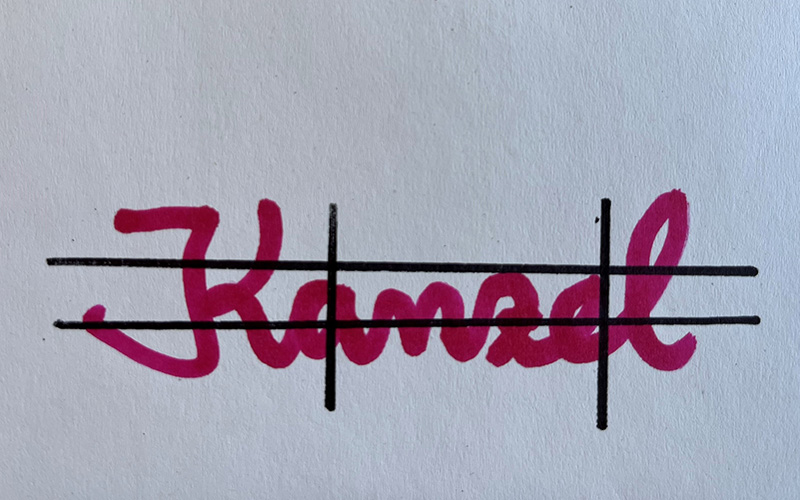
Wenn du in einer katholischen Kirche nicht predigen darfst, ist das ein klarer Fall von Kanzelkultur! Nur geweihte Männerfüße ab Diakon aufwärts dürfen den Bereich der Kanzel betreten und zur Predigt anheben. Für den Rest der Welt ist dieser Ort gesperrt, quasi abgezäunt. Deswegen heißt er ja auch „Kanzel“. Das lateinische Ursprungswort heißt „cancelli“ und bedeutet „Gitter“ oder „Zaun“.
Und was ist jetzt mit der noch berühmteren Cancel-Kultur? Auch hier landest du hinter Gittern, wenn auch meist nur typografisch. Denn früher, als man noch auf saubere Heftführung Wert legte, war es Usus, ein falsches Wort mit Lineal und Tinte viermal säuberlich durchzustreichen, zweimal von links nach rechts, zweimal von oben nach unten. Ein Gitterzaun. Das Wort war also durchgegittert.
Auch der Kanzler, der ursprünglich keiner Regierung vorstand, sondern nur einer Kanzlei, lebt in zäunlicher Trennung vom gewöhnlichen Volke. Denn Behörden und Gerichtsgebäude, wo die Kanzleien einmal saßen, waren früher ebenfalls abgezäunt.
Trümmerfrauen – ein deutsches Märchen

Wir alle kennen die Bilder: Kurz nach Kriegsende liegen die deutschen Städte im Schutt, doch Gruppen von Frauen steigen auf die Trümmerhaufen und tragen sie beherzt, fröhlich gar, wieder ab. Aufbauwille nach der Katastrophe! Immer gern auch erzählt mit dem Unterton: „Die Männer haben’s versaut, die Frauen bauen wieder auf.“
Stimmt halt bloß nicht. Die Trümmer sind auf andere Weise verschwunden; und die Trümmerfrauen nur Produkt einer Propaganda-Schau in West wie Ost.
Zunächst muss man wissen, dass Trümmerräumen für die Bevölkerung der deutschen Städte 1945 nix neues ist, man hat dies schon seit fünf Jahren getan: 1940 wird die erste deutsche Stadt bombardiert. Wer räumt auf? In erster Linie ganz normale Bauarbeiter unterstützt von Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern und verpflichtend herangezogenen Mitgliedern aus der Hitler-Jugend etwa oder dem Reichsarbeitsdienst.
Und wer räumt nach Kriegsende auf? Wiederum vor allem Bauarbeiter mit schwerem Gerät und Lkw unterstützt dieses Mal von kriegsgefangenen deutschen Soldaten und ehemaligen Mitgliedern der NSDAP (beide von den Besatzungsmächten dazu verdonnert). Der Frauenanteil in diesen Gruppen ist nahe Null. Es ist kein freiwilliges gemeinsames Anpacken: Enttrümmern ist eine Strafarbeit oder etwas, was man den Profis überlässt.
Nur in der sowjetisch besetzten Zone und in Berlin verpflichten die Besatzungsbehörden die Zivilbevölkerung immer mal wieder zum Arbeitseinsatz in den Trümmern, darunter dann tatsächlich auch nennenswert viele Frauen. Allerdings unter Androhung, sonst den Anspruch auf Lebensmittelscheine zu verlieren. Von Freiwilligkeit keine Spur. In Berlin und der Sowjetzone entstehen dann auch die Propaganda-Bilder der Trümmerfrauen, die heute alle kennen. Zum Teil als 1A-Inszenierung mit jungen Models, die geschminkt eine Eimerkette mimen, in die Kamera lachen und nach Drehschluss heimgehen.
1946/47 wird das Enttrümmern dann fast ausschließlich eine Angelegenheit der Baufirmen, die bis Mitte der 1950er Jahren damit beschäftigt sind. Der Mythos der Trümmerfrau lebt aber in West und Ost weiter. Die Geschichte ist einfach zu gut.
Die Zombie-Apokalypse ist da (echt jetzt)

Kein Genre wurde in den letzten zehn Jahren so totgeritten wie die Zombie-Apokalypse. Computerspiele, Romane, Filme, Serien sind voller wankender Toter auf der Suche nach Lebendigem.
Und jetzt ist sie da, die Zombie-Apokalypse. Kein Scherz.
Ich meine natürlich die Pandemie. Glücklicherweise läuft sie deutlich weniger drastisch ab als die Zombiegeschichten. Das neue Corona-Virus verzwirbelt zwar jedermanns Leben und beendet das von hunderttausenden. Verglichen mit dem Szenario aus The Walking Dead rüttelt hier aber nur ein kleiner Luftzug am Turm der Zivilisation. Nun ja, mir persönlich reicht’s eigentlich schon.
Was hat das Ganze jetzt mit Zombies zu tun? Nun, Viren sind seltsame Gestalten. Woher kommen sie eigentlich? Nach klassischer Auffassung bildet das RNA-Virus den ersten abgehenden Ast im Baum des Lebens. Auch Corona-Viren zählen zu den RNA-Viren. Demnach haben wir Menschen mit RNA-Viren die kleinste Anzahl gemeinsamer Vorfahren – mit Algenpilzen, Bärlauch und Seesternen teilen wir bei weitem mehr Ahnen.
Neuere Entdeckungen (zum Beispiel von bakteriengroßen Riesenviren) legen aber nahe, dass Viren vielleicht doch länger in der Großfamilie der restlichen Erdenwesen verblieben als bisher angenommen. Es könnte vielmehr so abgelaufen sein: Der Uropa der ersten Viren war eine echte Zelle mit allem Drum und Dran. Die Kinder und Enkel fanden jedoch Gefallen an einer bizarren Sexpraktik: Sie tricksten andere Zellen aus, fortan ihr Erbgut zu produzierten und für Viren-Nachwuchs zu sorgen. Der ganze Zellklimbim ist für diese Fortpflanzungsform überflüssig und so konnten Viren ihre Komplexität immer weiter reduzieren, bis sie biologisch gesehen tot waren, aber trotzdem einfach munter weitermachten. Ein evolutionärer Wiedergänger – ein Zombie!
Aber das ist noch nicht alles. Wir sagen hier so leichthin „biologisch tot“ – aber was heißt das? Stellen wir die Frage andersherum: Wie lautet die Definition für biologisches Leben? Sechs Kriterien:
- Homöostase. Das heißt, ein lebendiges System muss sich irgendwie aus sich selbst heraus aufrechterhalten und nicht etwa bei der ersten Gelegenheit einfach auseinanderfallen.
- Reizbarkeit. Das Ding muss irgendwie auf seine Umwelt reagieren können.
- Wachstum. Is’ klar.
- Vererbung. Das Ding muss Erbinformationen an seine Nachkommenschaft weitergeben.
- Stoffwechsel. Das System nimmt Teile seiner Umwelt in sich auf und verwertet sie. Einfacher: Es isst, atmet oder irgendwas in der Art.
- Fortpflanzung. Das Lebewesen kann aus sich heraus oder durch Paarung mit einem Artgenossen neues Leben erschaffen.
Die letzten beiden Kriterien treffen nicht auf Viren zu. Und damit sind sie raus aus dem Spiel des Lebens. Sie atmen nicht und sie können sich nicht selbst fortpflanzen. Moment mal – das ist ja wie bei Zombies!
Viren sind zunächst einfach mal da, wie ziellos schlurfende Zombies. Erst wenn sie in die Nähe einer geeigneten Zelle kommen, werden sie munter, wie Zombies, die lebende Menschen entdecken. Der „Biss“ kapert die Opferzelle und macht langsam, aber sicher ein platzendes Virennest aus ihr, so wie auch der gebissene Mensch selbst zum Zombie wird (wenigstens nur zu einem).
Das neue Corona-Virus ist evolutionär und biologisch gesehen also unser entfernter Zombie-Onkel. Und jetzt kommt er zu Besuch.
Darum war die Höhle besser

Hach, trautes Heim, Glück allein. Wie hielten unsere Urahnen das bloß aus, ständig durch die Wälder zu ziehen, stets in der Hoffnung auf ein erlegbares Mammut oder Beeren, stets in Furcht vor fauchenden Säbelzahnkatzen und Bären? Schutzsuchend von Höhle zu Höhle vagabundierend, Regen und stechender Sonne ausgesetzt. Es muss furchtbar gewesen sein.
Öhm, nein. Das eigentliche Elend des Homo Sapiens begann mit der Erfindung des Hauses und des Dorfes, der Viehzucht und der Landwirtschaft. Kurz: Die Sesshaftigkeit hätte die Menschheit fast umgebracht, denn sie zahlte einen ungeheuren Preis dafür. Die Diät der Steinzeit-Barbaren bestand aus Fleisch, Fisch, Früchten und Nüssen – eine gesündere Ernährung kann man sich kaum vorstellen. Ihre Brüder und Schwestern in den neolithischen Dörfern hingegen schlabberten täglich ihre verdünnte Getreidesuppe. Mangelernährung war die Folge und die armen Bauern litten ständig unter irgendwelchen Krankheiten. Wegen der ständigen Enge steckten sie damit das ganze Dorf an. Und aus den Latrinen, Ställen und Herden kamen immer neue Keime und Viren hinzu, die die Menschen dahinrafften.
Während die Nomaden jeden Monat in ein anderes, klimatisch freundlicheres Gebiet weiterzogen, waren die Dörfler an ihre Scholle gefesselt. Im Winter ging ihnen das Essen aus und Missernten oder Viehseuchen hungerten regelmäßig ganze Landstriche menschenleer. Hatten die Dörfler denn wenigstens mehr Spaß? Sehr wahrscheinlich nicht. Tatsächlich hatten die Barbaren nach erfolgreicher Jagd deutlich mehr Muße zum Rumlungern, Koitieren oder Musikmachen als die Dörfler und Hirten, die sich fast jeden Tag auf Feld und Weide abrackerten. Die ausgegrabenen Skelette der ältesten Sesshaften sind gekrümmt von harter Arbeit und Arthritis. Zusammengefasst: Die Wahrscheinlichkeit, ein kurzes, beschissenes Leben zu führen, war in den Dörfern weit höher als in den Wäldern.
Warum also um alles in der Welt haben die Menschen sich dies angetan? Homo Sapiens hat von Natur aus einen Hang zur Kultur. Und Kulturbildung ging erfahrungsgemäß stets mit dem Hunger nach Macht und Herrschaft über andere Sapiense einher. Leben und lebten nomadische Gruppen in weitgehend egalitären Gemeinschaften, in denen Werkzeuge, Entertainment und Nahrung halbwegs fair geteilt werden, so sieht das in Dörfern, Städten und Staaten ganz anders aus.
Dauerhafte Siedlungen mit Feldern und Tierherden sind eine verführerisch gute Voraussetzung für Brutalos, andere Leute für sich arbeiten zu lassen. Nur wenn jemand Eigentum besitzt, kann man es ihm auch wegnehmen. Sobald es einer mal mit einem festen Wohnsitz probierte, kam gleich ein anderer mit ’ner Schutzgeldforderung ums Eck: „Gib mir jeden Vollmond ein Schaf ab oder meine Jungs hier vermöbeln dich.“ Heute nennt man dieses Phänomen „Steuerbescheid“.
Grob bilanziert: Die Triebfeder der Sesshaftigkeit war ganz offensichtlich nicht der Drang zu einem besseren Leben, sondern die Knute der örtlichen Warlords. Diese Gewaltstruktur beschleunigte den zaghaft begonnenen Prozess der Sesshaftigkeit und verstetigte ihn.
Warum hauten die Leute nicht ab? Viele taten es. Schon in den allerersten uns überlieferten Gesetzen der Menschheit wird die Bestrafung von Zivilisationsflüchtlingen geregelt. Und auch ein großer Teil der Bevölkerung in den Urstädten war nicht freiwillig dort. Menschen wurden aus dem Umland geraubt und in den Städten zur Arbeit gezwungen, damit die Oberschicht sich militärisch ausbilden und das Getreidelager schützen konnte.
Die staatliche Megamaschine aus Krieg, Unterdrückung, Sklaverei und Armut – sie startete im ersten Dorf.
Wären wir doch lieber in den Höhlen geblieben.
Menschenfresser gab es nicht

Zumindest wahrscheinlich nicht. Wer kann schon beweisen, dass es etwas nicht gab?
Jedenfalls deutet alles darauf hin: Kannibalismus ist ein Mythos. Natürlich haben Menschen schon einmal andere Menschen gegessen, entweder aus Hungersnot oder aus Perversion – aber rituellen oder kulturell akzeptierten Kannibalismus gab es nie. Jedenfalls nie bewiesen, obwohl unzählige Male behauptet.
Erster Hinweis: Keine Kultur hat je von sich selbst gesagt, Kannibalismus zu betreiben.
Das bringt uns zur sozialen Funktion. Allerdings nicht zur Funktion des Kannibalismus‘, sondern zur Funktion des Kannibalismusvorwurfs. Historisch und psychosozial dient der Menschenfresservorwurf dazu, die Fremden zu denunzieren und der eigenen Gruppe zugleich eine höhere Moral zuzusprechen. Der Menschenfresser ist immer der andere.
Zweiter Hinweis: Der Kannibalismusvorwurf ist ein Grenzphänomen. Er trennt geistig-räumlich die Zivilisation von der Wildheit. Dehnten sich die Grenzen der eigenen „Zivilisation“ aus, wanderte auch der Kannibalismusvorwurf an die neuen Ränder. Als etwa die Wikinger Skandinaviens noch Heiden waren, unterstellte das christliche Europa ihnen Kannibalismus, sprich: die ultimative Unzivilisiertheit. Frisch zum Christentum übergetreten, begannen die Skandinavier ihrerseits damit, den heidnischen Lappen im Norden Kannibalismus vorzuwerfen. Je weiter die europäische Grenze sich ausdehnte, desto mehr Grenzvölker wurden von den Christen beweislos als Kannibalen denunziert: in Brasilien, Nordamerika, Papua-Neuguinea, im Kongo und so weiter.
Wie bei so ziemlich allen geschichtlichen Vorgängen, spielten übrigens auch hier Ökonomie und Macht eine Rolle: Denn mit dem Kannibalismusvorwurf konnte man prima rechtfertigen, andere Völker zu massakrieren, auszubeuten, zu kolonisieren und zu versklaven. Es traf ja nur unzivilisierte Barbaren. Zur „Bürde des weißen Mannes“ gehörte es also auch, fleißig das Gespenst des Kannibalismus‘ zu bekämpfen.
Nachtruhe ist etwas Neues

Nachts schläft der Mensch – am besten in einem Rutsch durch. In den USA waren das um 1900 rum im Schnitt pro Nacht noch zehn Stunden, in den 1950ern acht Stunden, inzwischen bloß noch sechseinhalb Stunden. Jedenfalls steht man hernach auf und der Tag kann losgehen. Normal, oder? Nö.
Denn die Menschen in Europa und anderen westlichen Ländern schlafen erst seit der Industrialisierung so, also seit rund 200 Jahren. Die Arbeiter, Schüler, Soldaten und Bürokraten sollten sich morgens frisch in den für alle gleichen Takt der Produktion, Schulanstalt, Armee oder Amtsstube einfügen. Bei rund 300.000 Jahren Geschichte schlafender Homo sapiens auf dem Planeten begann das quasi erst gestern.
Historisch belegt ist, dass die Menschen der frühen Neuzeit üblicherweise in zwei Phasen schliefen. Zum Beispiel so: Um sieben, acht sank man ins Bett und pennte drei, vier Stunden. Dann war man wieder wach und hatte ein, zwei Stunden Zeit für Nötiges und Spannendes: Holz aufs Feuer legen, mit dem Nachbarn reden, Briefe schreiben, Sex haben oder zum gerade angesagten Gott beziehungsweise Heiligen beten. Dann schlief man wieder vier, fünf Stunden. Auch am Tage gönnte man sich in der Regel ein, zwei kurze Schläfchen. Einen sozusagen natürlichen Schlafrhythmus gibt es deswegen noch lange nicht – die Menschen schliefen und schlafen je nach ortsüblichem Alltag einfach verschieden. Alles eine Frage der Anpassung.
Ein Komet zieht seinen Schweif nicht hinter sich her

In den Weiten des Alls surren massive Gesteinsbrocken durch den Raum (die kleinen nennt man Meteoriten, die großen Asteroiden) und dann gibt es noch Kometen. Kometen bestehen hauptsächlich aus Eis und Staub – ein dreckiger Schneeball sozusagen.
Charakteristisch für einen Kometen, den man von der Erde aus sehen kann, ist der Schweif, der manchmal mehrere hundert Kilometer lang sein kann. Er bildet sich nur, wenn der Komet in der Nähe der Sonne ist. Denn der Schweif entsteht durch den Strahlungsdruck des sogenannten Sonnenwindes. Die Sonne schleudert ständig geladene Teilchen ins All. An den Polen der Erde verursacht dieser Sonnenwind das Polarlicht. Bei Kometen bläst er Eis- und Staubpartikel an der Oberfläche einfach weg und lässt sie verglühen – das ist der Schweif.
Das heißt, der Kometenschweif bildet sich stets in die Richtung, in die der Sonnenwind „weht“, zeigt also immer von der Sonne weg – und hat überhaupt nichts mit der Flugrichtung des Kometen zu tun. Der Schweif kann auch vor dem Kometen sein.
Ist die Sonne dann weit genug weg, rasen die geschrumpften Schneebälle wieder ohne Schweif durch die Schwärze.
Münzgeld wurde erfunden, um Krieg zu führen

Das in der Schule gelehrte Märchen lautet: Münzgeld entstand, um besser tauschen zu können. Der Fischer steht auf dem Markt und hat zehn Fische, der Schreiner hat einen Stuhl. Der Fischer will einen Stuhl, der Schreiner will aber keinen Fisch. Ach, wenn sie doch bloß Geldmünzen hätten!
Solche frustrierenden Marktszenen gab es allerdings nie und die historische Realität sieht völlig anders aus: Münzen wurden erfunden, um Söldner für Krieg und Beutezug zu bezahlen. Aber was macht ein Söldner mit einer Münze, wenn er damit weder Fisch noch Stuhl erwerben kann?

Hier gibt es einen genialen Trick, auf den die herrschende Klasse fast überall gekommen ist: Gleichzeitig mit der Söldnerbezahlung erließ der örtliche Warlord (vulgo: König) ein Gesetz, das seine Untertanen zwang, Schutzgeld (vulgo: Steuern) zu zahlen – und zwar in Form von Münzen, die der Warlord selbst in Umlauf gebracht hatte. Damit waren die Münzen des Herrschers auf einmal etwas wert und die Soldaten konnten einkaufen gehen.
Bezahlt haben das Kriegsspektakel also die Abgabepflichtigen. Und das System nährte sich selbst: Die im Krieg gefangenen Sklaven schmiss man in die Bergwerke. Sie mussten Metalle für Münzen schürfen. Das Ergebnis: mehr Silber ⇒ mehr Söldner ⇒ mehr Krieg ⇒ mehr Sklaven ⇒ mehr Silber und so weiter.



