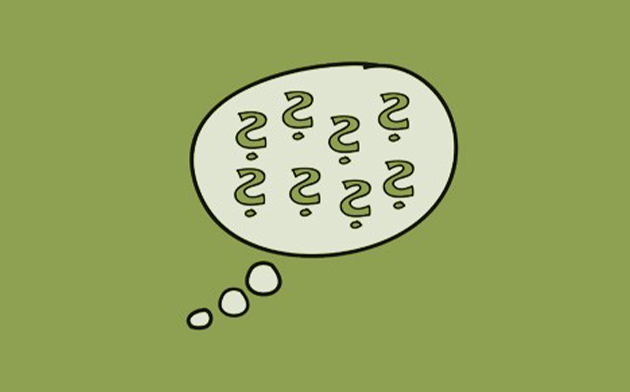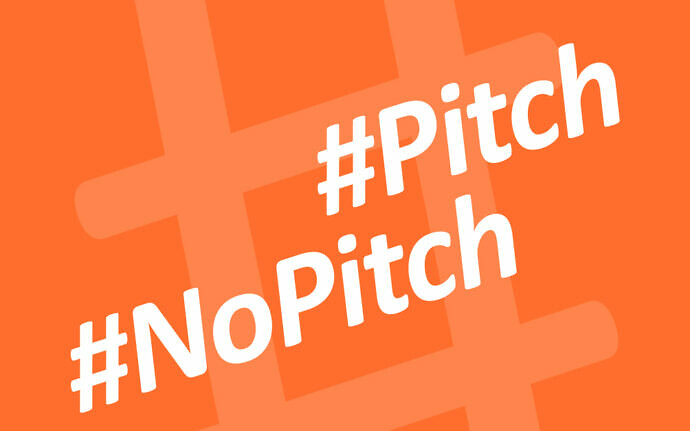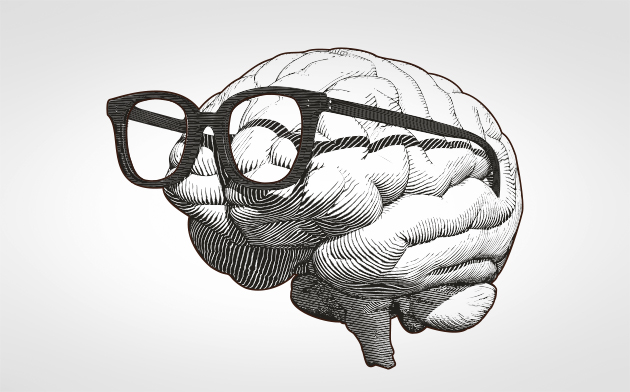Im Agentur-Alltag verwenden wir ganz selbstverständlich Begriffe, deren einheitliche Bedeutung überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ein knackiger Klärungsversuch – kein Brockhaus!*
Begriffsübersicht
- A/B-Test
- Bildsprache
- Blog
- Briefing
- broschürig
- BU
- Chemistry Meeting
- Content Hub
- Content Marketing
- Corporate Publishing
- Dolly
- Evaluation
- Exposé
- Haptik
- Hashtag
- Headline
- Input
- knackig
- Krisenkommunikation
- Leser / Leserin
- Leserbefragung
- luftig
- magazinig
- modern
- Moodboard
- Newsroom
- Online-Magazin
- Pitch
- Plot
- Proof
- Puffer
- Refresh
- Relaunch
- Responsive Webdesign
- Schnellleseelemente
- Social-Media-Content
- Storylistening
- Storytelling
- Teaser
- themenorientiert
- Timing
- Treatment
- Ziele
* Wir erweitern diese kleine Sammlung nach und nach.
Sie haben auch vermeintlich selbstverständliche Begriffe, die Sie ergänzen wollen? Einfach an lexikon@magaziniker.de schicken.
ABTest
[aˈbeːˈtɛst]
Bei einem A/B-Test, auch Split-Test genannt, werden zwei unterschiedliche Varianten ─ Variante A und Variante B ─ von einer Webseite, einem Newsletter oder einem Beitrag auf Social Media erstellt und getrennt voneinander veröffentlicht. Zum Beispiel probiert man zwei unterschiedliche Betreffzeilen in der E-Mail oder Teaserbilder im Social-Media-Post aus. Anschließend misst man, welche Version bei den Nutzern besser angekommen ist, also welche sie häufiger aufgerufen, geklickt, gelikt oder geteilt haben. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können Macher Webseiten nutzerfreundlicher gestalten und Content in Newslettern oder sozialen Medien besser auf die eigene Zielgruppe zuschneiden.
Bildsprache
[ˈbɪltʃpraːxə]
Steht für den Stil der Bilder, die in einem Beitrag oder Medium zum Einsatz kommen. Ein ansprechendes Bild lockt die Leser, verdeutlicht das Gelesene und unterstreicht die Aussage des Textes. Während hochwertige, aber schlichte Produkt- oder Stockbilder den broschürigen Charakter einer Publikation unterstreichen, sind ungewöhnlichere, inszenierte Fotos in Magazinen echte Hingucker und sorgen für überraschende Momente. Die Trends in der Magazinfotografie sind dabei höchst unterschiedlich.
Blog
[blɔɡ]
Ein Blog kommt im Vergleich zu einem Online-Magazin deutlich persönlicher und subjektiver daher. Hier legt der Autor oder die Autoren weniger Wert auf klassische journalistische Formate und Stilmittel. Im Vordergrund stehen persönliche Meinungen, Erfahrungen oder Wissen. Die visuellen Inhalte werden meist nicht mit so hohem Aufwand aufbereitet wie im Online-Magazin.
Briefing
[bʀiːfiŋ]
Die − schriftliche! – Grundlage für erfolgreiche Aufgabenbewältigung. Egal ob Pitch, Fotoshooting, Layout oder Text, ohne ein klares Briefing, in dem Aufgabenstellung und das gewünschte Ziel eindeutig umrissen werden, ist die Erreichung dieses Ziels purer Zufall – und Unzufriedenheit bei allen Beteiligten vorprogrammiert.
broschürig
[bʀɔˈʃyːʀɪç]
Die Broschüre ist für Blattmacher der Gegenentwurf zur Welt der Magazine: Eine werbliche Informationsschrift, die sich durch eine strenge Orientierung am Corporate Design in Schriften und Farben, durch ein eindimensionales, standardisiertes Raster und Stockfotografiewelten auszeichnet. Daraus resultiert gestalterische und inhaltliche Gleichförmigkeit. Überraschungen sind nicht erwünscht – es zählt der Fokus auf das Produkt oder die Dienstleistung. Da Broschüren oft in hoher Auflage erscheinen und Überarbeitungen unterworfen sind, zählt bei Papier und Verarbeitung in erster Linie der Preis, weniger das haptische Erlebnis.
BU
[bəˈuː]
BU ist die geläufige Abkürzung für Bildunterschrift. Bildunterschriften sind die am meisten unterschätzten Texte innerhalb eines Magazins. Unerfahrene Redakteure feilen stundenlang an Absätzen, die sich mitten in einem Buchstabenwald verstecken, und klatschen kurz vor Abgabe noch eine lieblose BU unter die Artikelbilder. Dabei ist die Wirkung von BUs auf Leser gewaltig: Der Blick beim Magazinblättern fällt immer zuerst auf die Bilder, dann in der Regel auf Bildunterschriften, danach auf Headlines und erst dann auf andere Schnellleseelemente und schließlich den Fließtext. Die BU wird also in der Regel als erstes gelesen.
Chemistry Meeting
[ˈkemɪstri ˈmiːtɪŋ]
Kein kartellrechtlich relevantes Industrietreffen, sondern eine effiziente Alternative zum klassischen Pitch, wenn es um die Auswahl einer neuen Agentur geht. Hierbei treffen sich die Entscheider mit zwei bis drei vorab ausgewählten Kreativdienstleistern zu einem Workshop. Das Augenmerk liegt dabei auf der Art und Weise wie die Zusammenarbeit funktioniert und wie sie sich anfühlt – weniger auf dem Ergebnis selbst. Dabei sollten Rahmenbedingungen, Aufgabenstellung und Entscheidungskriterien für alle teilnehmenden Agenturen gleich sein. Macht sich der Auftraggeber im Vorfeld bewusst, welche Art von Dienstleister er braucht, zum Beispiel Kreativling oder Arbeitstier, führt diese Methode in der Regel deutlich schneller, einfacher und ressourcenschonender zum Ziel.
Content Hub
[ˈkɔntɛnt hʌb]
Der Begriff Content Hub bezeichnet den Knotenpunkt, an dem alle Marketing- und Kommunikationsinhalte gebündelt werden. Hier laufen alle Fäden zusammen: Er ist die Anlaufstelle für Besucher und zentrale Verteilstelle für alle Content-Marketing-Aktivitäten. Er ist jedoch kein Ersatz für konzeptionell durchdachte Publikationsformen und keine Abwurfstelle für zufällig entstandenen Content. Nach außen hin kann ein Content Hub verschiedene Erscheinungsformen haben – die eines Online-Magazins, eines Blogs oder eines Web-Portals.
Content Marketing
[ˈkɔntɛnt maʁ.ke.tiŋ]
In erster Linie bezeichnet dieser Begriff die Gegenidee zu klassischer Einbahnstraßen-Werbung. Um Botschaften zu vermitteln, sollen Unternehmen auf für Empfänger nützliche Inhalte und deren gezielte Vermittlung über alle möglichen, vor allem digitale Kanäle, setzen. Und zwar mithilfe einer klaren Strategie, die auf Auswertung aller verfügbarer Daten basiert und deren Erfolg ständig kontrolliert wird.
Danach gilt es, Folgendes herauszufinden:
- Ziel: Was soll die Kommunikation erreichen?
- Nutzen: Welche Informationen wollen die Empfänger haben?
- Kanal: Wo erreiche ich die Empfänger am besten?
- Inhalt: Wie müssen die Inhalte dafür aussehen?
- Wirkung: Erreichen die veröffentlichten Inhalte die gesetzten Ziele?
Insofern ist Content Marketing lediglich ein neuer Begriff für strategisch ausgerichtete Unternehmenskommunikation im digitalen Zeitalter.
Corporate Publishing
[ˈkɔːp(ə)rət pʌblɪʃɚɪŋ]
Bezeichnet die Veröffentlichung journalistisch aufbereiteter Inhalte der Unternehmenskommunikation – intern wie extern. Historisch gesehen schwingt im Begriff eine starke Print-Orientierung mit, allerdings ist Corporate Publishing heute durchaus kanalunabhängig zu verstehen, und bezieht Kunden- und Mitarbeitermedien aller Art, vor allem gedruckte, aber auch online Magazine sowie die Social-Media-Kommunikation mit ein. Aufgrund der Wahl journalistischer Mittel grenzt sich das Corporate Publishing zur Broschüre ab. Die Abgrenzung zum Content Marketing ist hingegen nicht trennscharf.
Dolly
[ˈdɒli]
In Bezug auf Video meint „Dolly“ nicht etwa das berühmte Schaf, sondern ein technisches Hilfsmittel. Ein Dolly ist ein Schlitten, auf dem sich die Kamera befindet, und der ruckelfreie Kamerafahrten erlaubt. Der Schlitten läuft auf Schienen und wird vom Kameramann bewegt. Aufnahmen mit Dollys (sog. „Dolly-Shots“) wirken besonders effektvoll, wenn die zurückgelegte Strecke lang ist und bieten sich etwa bei großen Produktionshallen an. Grundsätzlich sind sie in alle Richtungen möglich – sogar im Kreis herum.
Evaluation
[evalu̯aˈʦi̯oːn]
Evaluation bedeutet Bewertung. Im engeren Sinne bezeichnet sie alle Methoden zur Messung des Grads der Zielerreichung. Evaluation setzt also voraus, dass (bewert- oder messbare) Ziele definiert wurden. Kennzeichen einer professionellen Evaluation sind transparente Bewertungskriterien und anerkannte, nachvollziehbare Methoden der Datenerhebung. Eine verbreitete Methode zur Bewertung von Magazinen ist die Leserbefragung.
Exposé
[ɛkspo’ze:]
Ein Exposé ist die Vorstufe eines ausgearbeiteten Treatments. In Form einer Kurzgeschichte zeigt es die Handlung des umzusetzenden Videos und soll dazu dienen, Auftraggebern einen ersten Eindruck über das Video zu verschaffen und sie dafür zu gewinnen. Dabei sollte es nicht zu tief ins Detail gehen und – im Gegensatz zum Treatment – keine Regieanweisungen beinhalten. In der Regel reicht für ein Video-Exposé eine Seite.
Hashtag
[ˈhæʃtæɡ]
In sozialen Medien wie Instagram, Facebook, Twitter und Co. sind sie in fast jedem Beitrag zu finden – mal dezent, mal in großer Flut. Die Rede ist von Hashtags. Mit ihrem Doppelkreuz # (engl. hash) haben sie die Macht, einzelne Begriffe eines Textes in Schlagworte (engl. tags) zu verwandeln. Wird aus einem „Magazin“ ein „#Magazin“ wird der Beitrag allen Magazinbegeisterten auf Instagram & Co. angezeigt. Mit einem Hashtag verknüpft man also Beiträge mit interessanten Themen. Die Beiträge werden dadurch öfter gesehen ─ und das auch noch von der richtigen Zielgruppe. Aber Achtung: Verwendet man Hashtags inflationär, um möglichst viele Views, Likes oder Kommentare abzustauben, bestrafen einen die Algorithmen der Social-Media-Plattformen schnell.
Haptik
[ˈhaptɪk]
Was wir berühren und fühlen, bleibt stärker im Gedächtnis. Im Editorialdesign ist das haptische Erlebnis deshalb ein wichtiges, aber oft stiefmütterlich behandeltes Instrument. Durch die gezielte Papierwahl oder bewusst eingesetzte Veredelungsmethoden (z.B. Präge- oder Stanztechniken) wird Magazingestaltung erst vollkommen. Wichtig ist, dass die Haptik zum Charakter des Hefts passt. So verleiht zum Beispiel Recyclingpapier einer Zeitschrift mit Schwerpunkt DIY oder Crafting ein authentisches Image. Beim Magazin eines Finanzinvestors führt es dagegen zu Irritationen beim Empfänger. Hier ist ein hochwertiges, edles Papier gefragt.
Headline
[ˈhɛdla͜in]
Eine Headline soll den Leser dazu bringen, zu lesen. Sie zwingt ihn dazu, sich mit ihr auseinanderzusetzen: zum Beispiel weil die Headline etwas behauptet, den Leser zu etwas auffordert oder ihm etwas verspricht. Gute Headlines erzählen oft selbst schon eine kleine Geschichte, benutzen kurze, starke, handlungsorientierte Wörter. Die Kür schafft ein Texter, wenn er mit der Headline noch das Echsenhirn des Lesers reizt und mit den Urtrieben spielt: mit Angst, Sex, Gier, Liebe, Tod zum Beispiel. Hier erfahren Sie, was eine Headline ausmacht und wie man sie richtig knackig formuliert.
Input
[ˈɪnpʊt]
Ein Computer kann ohne Eingabe keine Befehle ausführen, und ein*e Autor*in kann ohne Informationen keinen Text verfassen. Also auf zur Recherche und her mit allem Hintergrundmaterial, das zum Thema passt: Studien, White Paper, Konzepte, Fachartikel und Präsentationen. Bildmaterial, vor allem Videos, sind pures Recherchegold, um das Produkt in Aktion zu sehen.
Im nächsten Schritt sollte ein Input-Gespräch mit einer Ansprechperson auf der Agenda stehen. Dieser O-Ton ist vor allem dann wichtig, wenn der Beitrag die Perspektive eines Experten oder Kunden wiedergeben soll. Hier gilt: das Gespräch unbedingt festhalten, um sich bei späteren Gedächtnislücken selbst auf die Sprünge zu helfen. Das kann in Form von handschriftlichen Notizen oder einer Aufnahme sein.
Dann werden die Infos analysiert, bewertet und nach Relevanz sortiert. Die wichtigsten Fragen, die in einen Text gehören sind: Wer? Wo? Wie? Wann? Warum? Bewaffnet mit jeder Menge Input kann der Schreibprozess beginnen.
knackig
[ˈknakɪç]
„Knackig“ bezieht sich im Journalismus meist auf die Formulierung einer Headline. Soll eine Headline knackiger werden, bedeutet das in der Regel, dass sie ihren Daseinszweck noch nicht erfüllt: den Leser dazu zu motivieren / überreden / provozieren, die Lektüre des Artikels aufzunehmen.
Krisenkommunikation
[ˈkʁiːzənkɔmunikaˈt͡si̯oːn]
In einer Krise treten große Veränderungen überraschend ein, die ein hohes Maß an Unsicherheit und finanzieller Gefahr bergen. Kunden, Lieferanten, Investoren und vor allem Mitarbeiter sind verunsichert. Unternehmen müssen nun informieren, aber auch via Storytelling und geeignetem Content strategische Kommunikationsziele wie Werte, Haltung und Hintergründe nach außen und innen vermitteln. Doch das können sie nur glaubhaft tun, wenn sie in der Vergangenheit bereits Kanäle aufgebaut haben, über die sie offen und transparent kommunizieren und die das Vertrauen der internen und externen Zielgruppen genießen. Dies gilt für persönliche Kontakte und die Kommunikation über Printmagazine, Onlinemagazine, Intranet, soziale Medien oder Unternehmens-Apps gleichermaßen.
Merke: Das Vertrauen der Zielgruppen muss man sich vor der Krise verdienen. Offene und transparente Kommunikation kann sich nicht auf Krisenzeiten beschränken. Denn nach der Krise ist vor der Krise.
Leser / Leserin
[ˈleːzɐ] / [ˈleːzərɪn]
Der Leser / die Leserin ist im Corporate Publishing oft ein unbekanntes Wesen. Dabei ist – nicht erst seit Content Marketing – das Wissen über die Wünsche der Zielgruppe für den Erfolg der Unternehmenskommunikation essenziell.
Bei der externen Kommunikation gilt „Know your customer“. Die klassische Leserumfrage zum selber ausfüllen greift dabei oft viel zu kurz, weil sie a) nur die aktiven Leser anspricht und b) in der Regel nur die Fans des Magazins antworten. Fokusgruppengespräche oder der direkte Draht zum eigenen Vertrieb sind hier zielführende Werkzeuge. Bei der internen Kommunikation ist ein Leserrat ein probates Mittel. Im Digitalbereich lassen zum einen Nutzungsdaten, zum anderen Interaktionen wie Likes, Kommentare oder Sharing Rückschlüsse auf die Präferenzen der Leser zu.
Leserbefragung
[ˈleːzɐbəˈfʀaːɡʊŋ]
Überbegriff zur Evaluation von Kunden- und Mitarbeitermagazinen. Die wohl bekannteste Methode ist die quantitative Befragung auf Basis standardisierter Fragebögen. Wichtig für den Erkenntnisgewinn ist bei dieser Methode die Repräsentativität der Ergebnisse und ein professionelles Fragebogendesign.
Die qualitative Leserbefragung eignet sich, ein Stimmungsbild zu zeichnen. Sie liefert oftmals völlig neue Erkenntnisse, da Leser in offenen Interviews animiert werden, möglichst viel aktiv mitzuteilen. Mittels der qualitativen Leserbefragung lassen sich beispielsweise die Ergebnisse einer quantitativen Befragung interpretieren oder vor einem Relaunch die Bedürfnisse und Interessen der Leser eruieren. Eine Technik der qualitativen Befragung ist das Storylistening.
luftig
[ˈlʊftɪɡ]
In einem Kiosk tummeln sich auf engstem Raum Zeitschriften, Zigaretten, Schokoriegel und Ansichtskarten. Voll bis obenhin – totale Reizüberflutung. Auch ein Layout kann schnell zum Kiosk werden. Maximalen Inhalt auf minimale Fläche zu quetschen, gibt dem Betrachter nicht das Gefühl, möglichst gut informiert zu werden. Vielmehr schreckt es ab, überreizt das Auge und stört den Lesefluss. Dagegen geht ein „luftiges“ Design respektvoll mit Text und Bild um und lässt den einzelnen Elementen so ausreichend „Luft zum Atmen“. Es lenkt den Blick und die Aufmerksamkeit des Betrachters, indem es Inhalte ganz bewusst auf der Fläche inszeniert und dadurch Ordnung schafft. Wenn das Layout die Balance zwischen gefüllter und blanker Fläche hält, entsteht das, was wir als ein „luftiges“ Design bezeichnen.
magazinig
[maɡaˈʦiːnɪç]
Der Begriff „Magazin“ stammt ursprünglich aus dem Arabischen („Makhzan“) und bedeutet „Warenlager“ oder „Schatzkammer“. So kombiniert der Begriff eine reiche Sammlung von nützlichen und schönen Dingen – Dinge, die es wert sind, aufbewahrt zu werden. Der Besuch eines solchen Lagers lädt sowohl dazu ein, durch die Vielfalt zu schlendern und Neues, Nützliches entdecken zu können, aber sich auch einfach am Glanz der schönen Dinge zu erfreuen.
Blattmacher im Corporate Publishing verwenden das Adjektiv „magazinig“ in der Regel zur Abgrenzung zu einer broschürigen Herangehensweise vor allem bei Inhalt und Gestaltung. Aber auch Material, Umfang und Produktionsaspekte können hier eine Rolle spielen. Ein Magazin als imagebildendes Medium legt Wert auf einen dramaturgisch anspruchsvollen Mix aus unterschiedlichen journalistischen Formaten, auf Geschichten, auf Raum für Inszenierung, lesefreundliche wie ansprechende Typografie, auf großzügige Bilderwelten und überraschende Umsetzungen. Neben der inhaltlich-visuellen Ebene liegt beim Magazin das Augenmerk zudem auf haptischer Wertigkeit, also wertiger Verarbeitung und Qualitätspapieren.
modern
[moˈdɛʁn]
„Modern“ bezeichnet die Stilrichtung in Musik, Malerei und Literatur grob zwischen 1890 und 1950 – ist also schon eine Weile her. Spricht man heute landläufig von „modern“ meint man eher etwas, das dem aktuellen Geschmack entspricht. Im Magazinjournalismus wie auch sonst wirft dies das Problem auf, dass es im Hier und Jetzt ganz viele verschiedene Geschmäcker gleichzeitig gibt. Ein modernes Managermagazin unterscheidet sich von einer modernen Meditations-Postille. Dennoch: Es gibt Stilrichtungen, die zugleich in alle Magazine drängen. Flat Design etwa für Illustrationen und Websites oder die Einbindung von Social-Media-Content in einen Online-Artikel. Wer sagt: „Das soll modern sein“, formuliert einen Anspruch, sagt aber noch nichts darüber aus, wie er erreicht werden soll.
Moodboard
[ˈmu:dboːɐ̯t]
Der Designprozess beginnt häufig nur mit einer abstrakten Idee oder Vorstellung. Das Moodboard ist eine beliebte und zeitsparende Methode, um die Stimmung oder das Gefühl der angestrebten Gestaltung greifbar zu machen. Früher erstellten Designer ein Moodboard, indem sie verschiedene Elemente als Collage von Hand auf Karton klebten. Heute erstellen sie die Mischung aus Bildern, typografischen Elementen, Mustern, Illustrationen oder Schlagworten meist digital. Bei der Magazinentwicklung, dem Relaunch oder der Gestaltung komplexer Magazinstrecken nähern sich Grafiker mit Moodbards dem Design an, ohne mit echten Inhalten zu layouten.
Newsroom
[ˈnjuːsruːm]
Obwohl der Begriff, den Sie vielleicht schon von Medienhäusern kennen, anderes vermuten lässt, muss ein Newsroom nicht immer ein tatsächlicher Raum in einem Gebäude sein. Es kann sich auch um einen virtuellen Raum handeln oder schlicht um eine einzige Excel-Datei. Wichtig ist: Dort werden von allen Kommunikationsverantwortlichen aus den unterschiedlichen Bereichen Themen eingesteuert, aus denen dann kanalspezifisch aufbereitete Geschichten entstehen. Es gilt: Storytelling first! Oder anders gesagt: Der Newsroom ist eine zentrale, transparente Sammelstelle für Content, in dem sowohl die interne als auch die externe Kommunikation geplant werden können – immer vom Thema her denkend. Schöner Nebeneffekt: Sammeln Sie die Themen an einem Ort, haben Sie den Überblick über die Kommunikationsaktivitäten in Ihrem Unternehmen, verhindern Doppelarbeit und können durch die kanalspezifische Aufbereitung mehrere Geschichten in einem Schritt abstimmen.
Online-Magazin
[ˌɒnˈlaɪn magaˈtsi:n]
Wie ein gutes Print-Magazin will auch ein Online-Magazin, den Leser mit Storytelling gewinnen und zum Lesen und Stöbern motivieren. Dazu gehören eine Reihe von Zutaten: eine breite Klaviatur an journalistischen Formaten, eine starke visuelle Aufbereitung, eine eigene Bildsprache – und natürlich eine klare journalistische Idee, was das Magazin dem Leser bieten will. Anders als beim Print-Magazin, wo schon fast alles ausprobiert worden ist, bieten Online-Magazine fürs Storytelling noch jede Menge Raum für Kreativität: Derzeit werden Geschichten crossmedial (Bild, Schrift, Ton und Bewegtbild) gerne durch Scrollytelling oder Parallax Scrolling umgesetzt.
Pitch
[ˈpɪtʃ]
Klassischer Weg einen neuen Dienstleister auszuwählen. Im Wettbewerb der Ideen treten vorab ausgewählte Agenturen zu einer mehr oder weniger klar umrissenen Aufgabe gegeneinander an. Ein professioneller Pitch ist für alle Beteiligten extrem aufwändig, nicht immer stehen Aufwand und Nutzen in einem gesunden Verhältnis. Eine Alternative zum Pitch ist zum Beispiel das Chemistry Meeting. Neben professionellen Ausschreibungen in denen Fairness, Realismus und Respekt vor der Kreativ- und Investitionsleistung der Teilnehmer selbstverständlich sind, gibt es leider auch regelmäßig Frust: schlechte Briefings, absurde Aufgabenumfänge, irrwitzige Timings oder gleich dreistes Ideenabschöpfen, am besten noch unbezahlt. Beispiele für gute und schlechte Pitches zeigt der Pitchblog.
Plot
[plɒt]
Bevor ein Magazin auf die Druckmaschine kommt, erstellt der Drucker einen Plot. Er wird mit den finalen Daten für den Druck erstellt und ist die letzte Möglichkeit, inhaltliche und formale Fehler, wie zum Beispiel Tippfehler, falsche Seitenzahlen, Fehler bei der Seiten-Reihenfolge, dem Beschnitt oder der Position der Bilder, zu finden und auszubügeln. Im Gegensatz zum Proof ist ein Plot nicht farbverbindlich.
Proof
[pru:f]
Ein Proof oder Prüfdruck ist eine farbverbindliche Simulation des Druckergebnisses unter Berücksichtigung der Papiersorte. Er ermöglicht im Gegensatz zum Plot eine genaue Qualitätskontrolle der Farbigkeit, insbesondere der Fotos. Beim Proof erstellt der Drucker oder die Reprotechnik nur ein Abbild der Fotos und Illustrationen des Heftes. Denn diese lassen sich digital – selbst am besten Monitor – nicht gut genug beurteilen.
Puffer
[ˈpʊfɐ]
1. Gericht aus geriebenen Kartoffeln. 2. Gut gehütetes, geheimes Element eines jeden Zeitplans. Puffer sind wie Blähungen: Jeder hat sie, aber niemand spricht gerne darüber. Denn auf Puffer greift man immer nur dann zurück, wenn es eng wird im Timing. Dann kommt die leicht verschämte Frage: Wie groß ist denn unser Puffer? Und dann geschieht das Wunder: Druckereien etwa machen auf einmal Magazine in drei Tagen übers Wochenende fertig, wofür sie sonst sieben Werktage voraussetzen. Und ja, auch die Magaziniker haben zum Glück immer mal wieder einen Puffer im Ärmel (dem sogenannten Puffärmel). Die Kunst ist es, nicht zu viel Puffer vorzusehen, weil sie sonst nur zu Aufschieberei führen und letztlich – ähnlich wie Blähungen – einfach verpuffen.
Refresh
[rɪˈfreʃ]
Stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich nicht mehr wohl in Ihren vier Wänden. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie bauen ein neues Haus (Relaunch) oder sie kaufen neue Möbel und tapezieren frisch: ein Refresh. Bei einem Magazin – egal ob Print oder online – stellen sich dann Fragen, wie: Passt die Typo noch? Wollen wir das Inhaltsverzeichnis oder den Websitekopf mal neugestalten? Wollen wir eine neue Rubrik einführen? Refreshs sind keine Folge einer strategischen Neuausrichtung. Sie zielen vor allem darauf, die bereits etablierten Strukturen chic zu machen, haben also gestalterischen Charakter. Da Unternehmensmedien zu den Produkten gehören, die ziemlich rasch altern, empfiehlt sich ein Refresh spätestens nach drei Jahren. Er ist meistens schnell und unkompliziert und kann am laufenden Projekt durchgeführt werden.
Relaunch
[ˈriːlɔːntʃ]
Stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich nicht mehr wohl in Ihren vier Wänden. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie kaufen neue Möbel und tapezieren frisch (Refresh) oder Sie reißen Ihr Haus ab und bauen auf dem alten Fundament ein neues: ein Relaunch. Letzterer ist natürlich aufwändiger. Für ein Magazin oder eine Website gilt dann, dass noch einmal alles neu gedacht werden muss: Zielgruppe, Rubriken, gestalterischer Aufbau, Dramatik, Erzählweise, Bildersprache, Themen – oder kurz: Was wollen wir sein? Einen Relaunch macht man nicht zwischen zwei Mittagspausen, denn es braucht Zeit und Mut für grundsätzliche Fragen. Dafür kann der Häuslebauer am Ende stolz darauf sein, etwas Neues und Großartiges geschaffen zu haben.
Responsive Webdesign
[rɪˈspɒnsɪvˈwɛbˈdiˈzaɪ̯n]
Responsive Webdesign (auf Deutsch etwa „reagierende Websitegestaltung“) soll dafür sorgen, dass die Inhalte von Webseiten auf jedem Gerät – egal ob Desktop, Tablet oder Smartphone – optimal angezeigt werden. Navigationselemente, Aufbau, Bilder und Videos passen sich dafür der Bildschirmgröße an und die Seiten können via Maus oder Finger bedient werden. In der Praxis bedeutet es, dass Online-Redakteure immer verschiedene Größen mitdenken und bei Bildzuschnitt und Sonderfeatures kreativ agieren müssen. Ein und derselbe Artikel kann also bei verschiedenen Betrachtern ziemlich unterschiedlich aussehen. Für kontrollwütige Art Directoren eine echte Herausforderung, locker zu bleiben und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Schnellleseele mente
[ˈʃnɛlˈleːzə-eleˈmɛntə]
Weniger sperrig als ihre Bezeichnung sollten Schnellleseelemente daherkommen. Headlines und Sublines, (kurze) Vorspänne, Zwischenüberschriften, Spitzmarken, Zitate oder Infokästen sollten sein, wie der „Gruß aus der Küche“: kleine, überraschende Informationshäppchen, die Appetit auf mehr machen. Aber ihre Aufgabe ist es nicht, nur Interesse zu wecken. Schnellleseelemente strukturieren auch den Text, heben Wichtiges hervor und helfen dem Leser bei der Orientierung. Wie Forscher mit der Eyetracking-Methode belegen, lenken Leser ihren Blick nach Bild und Bildunterschrift auf die Schnellleseelemente und erst danach (vielleicht) auf den Text. Deshalb ist hier die ganze Kunstfertigkeit des Redakteurs gefragt.
Social-Media-Content
[ˈsɔʊ̯ʃl̩ ˈmiːdi̯ə ˈkənˈtent]
Social-Media-Content bezeichnet Texte, Bilder und Videos, die Unternehmen für soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, LinkedIn oder Instagram produzieren. Die Inhalte sollen Reichweite durch Likes, Shares oder Retweets generieren, eine direkte Interaktion mit den Nutzern ermöglichen oder neue Follower anlocken. Damit das gelingt, bringen Redakteure Botschaften in wenigen Zeichen auf den Punkt, übersetzen sie in ein ansprechendes Motiv und behalten dabei die Besonderheiten der einzelnen Kanäle im Blick: Während beispielsweise der Text bei LinkedIn fachlich etwas tiefer schürfen sollte, ist auf Facebook eher Boulevard gefragt. Pinterest oder Instagram leben ausschließlich von starken Bildern.
Storylistening
[ˈstȯr-ē-ˌli-sən-iŋ]
Der Begriff beschreibt den in der Unternehmenskommunikation gelegentlich vernachlässigten Teil eines Dialogs: das Zuhören. Darüber lasst sich die zentrale Frage beantworten: Wer bin ich jetzt, beziehungsweise wie werde ich gesehen? Welche Geschichten erzählen Kunden, Mitarbeiter und Leser über mich? Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Welche würden sie gerne machen? Storylistening liefert die Außensicht und ist damit der Ausgangspunkt, von dem aus Geschichten im Sinne des Storytellings entwickelt werden. Storylistening kann auch als Evaluationsmethode im Rahmen einer Leserbefragung eingesetzt werden.
Storytelling
[ˈstȯr-ē-ˌte-liŋ]
Neben Content Marketing ist Storytelling, zu Deutsch „Geschichten erzählen“, eines der häufigsten Schlagworte der letzten Jahre in der Unternehmenskommunikation. Der Begriff besagt, dass sich Botschaften besser im Gehirn des Empfängers verankern, wenn sie der Erzählform folgen. Die wichtigsten Zutaten: Ein Handlungsstrang, agierende Personen und ein Problem, das es zu lösen gilt. Storytelling wird oft als Allzweckwaffe in der Unternehmenskommunikation (intern und extern) propagiert. Die kann aber auch nach hinten losgehen. Nämlich dann, wenn Geschichten nicht authentisch sind oder Selbst- und Fremdbild zu weit auseinanderklaffen. Dann wird die Story unglaubwürdig. Deshalb empfehlen Fachleute vor dem Storytelling das Storylistening.
Teaser
[ˈtiːzɐ]
DIESER TRICK wird Sie SCHOCKIEREN!
So oder so ähnlich versuchen Clickbait-Seiten im Netz, Menschen auf ihre Plattform zu locken. Genau diese Taktik muss der oder die Autor*in anwenden, um seinen oder ihren Text der Leserschaft schmackhaft zu machen. Das Wort Teaser leitet sich aus dem Englischen ab von „to tease“. Zu Deutsch: jemanden reizen. Damit ist nicht den „Lesenden bis aufs Blut reizen“ gemeint, sondern den Lesenden anlocken. Der Teaser ist ein Vorspann in Form eines kurzen Textes, der zum Weiterlesen motiviert. Ein guter Teaser gibt, zusammen mit Bild und Überschrift, einen Ausblick darauf, wovon ein Text handelt. Er soll Neugierde auf den kommenden Artikel wecken, aber nicht zu viel verraten. Dieser Trick nennt sich „den Lesenden anteasern“. Das war jetzt nicht so schockierend, oder? Dann bitte weiterlesen, der nächste Abschnitt wird Sie wirklich UM DEN VERSTAND BRINGEN!
P.S.: Im Gegensatz zum Clickbaiting halten gute Autor*innen mit ihrem Text, was der Teaser verspricht.
themenorientiert
[ˈteːmen oriɛntiːɐ̯t]
Themenorientiertes Arbeiten geht in der Kommunikation – wie der Name schon sagt – vom Thema aus. Ein Beispiel: Ein neuer CEO beginnt. Ausgehend von diesem Thema überlegt man sich: Welche Geschichte möchten wir welcher Zielgruppe erzählen? Wann? In welchem Format? Und welche der internen sowie externen Kanäle eignen sich dafür? Eine persönliche Videobotschaft für intern und ein längeres Portrait für die Website? Erst nach diesen Überlegungen startet man die kanalspezifische Umsetzung. Der Vorteil: Packt man das Thema an, macht man dies für mehrere Kanäle gleichzeitig. Das erleichtert die Abstimmung mit dem vielbeschäftigten CEO und verhindert Doppelarbeit in der Kommunikationsabteilung.
Timing
[ˈtaɪ̯mɪŋ]
Dient zur zeitlichen Abstimmung eines Projekts und ist im besten Fall eine realistische, chronologische Abfolge der verschiedenen Aufgaben bis zum Projektabschluss. Es ist hilfreich, das Timing
- in Teilziele, sogenannte Meilensteine, zu unterteilen
- mit den am Projekt beteiligten Personen abzustimmen und die Verantwortung für jede Aufgabe klar zu benennen
- mit Hilfe eines Tools zu erstellen (zum Beispiel: OpenProject, GanttProject oder Libreplan)
- von hinten (zum Beispiel: Erscheinungstermin) nach vorne (zum Beispiel: Themenrecherche) zu errechnen.
Das Timing ist da, um eingehalten zu werden. Wenn sich aber doch einmal der Start oder der Termin eines Meilensteins verschiebt, ist es wichtig, dass die benötigte Zeit für jede Etappe, auch ohne konkrete Terminzuordnung, bestehen bleibt. Spielraum ist allenfalls möglich, wenn in weiser Voraussicht Puffer eingeplant wurden.
Treatment
[ˈtriːtmənt]
Ein Treatment ist eine detaillierte und chronologische Beschreibung dessen, was der Zuschauer in einem Video sehen wird. Es ist in einzelne Kamerabilder (Einstellungen) unterteilt und beinhaltet ebenso Informationen darüber, wann geschnitten oder überblendet wird. Darüber hinaus steht darin, was der Zuschauer hören wird – Musik etwa oder Sprechertext. Es geht darin deutlich über das Exposé hinaus, welches die Handlung des Videos in Form einer Kurzgeschichte lediglich umreißt.
Ziele
[tsiːlə]
Sie kommen im Alphabet am Ende, sollten bei der Unternehmenskommunikation aber immer ganz am Anfang stehen: Ziele. Schließlich ist hier Kommunikation kein Selbstzweck. Egal, ob nach innen oder außen, die Unternehmenskommunikation verfolgt implizit vielfältigste Ziele: von der Unterstützung eines Zusammengehörigkeitsgefühls bis zur Generierung von Leads. Umso expliziter diese Ziele formuliert sind, desto zielgerichteter können die Verantwortlichen die jeweilige Kommunikationsmaßnahme zuschneiden, umsetzen und den tatsächlichen Erfolg messen. Klingt banal, ist aber leider keine Selbstverständlichkeit.